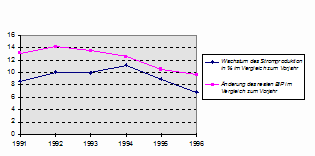|
Infrastruktur - China |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3. Energieversorgung in China 2.3.1. Energieversorgung und Wirtschaftswachstum Zur Infrastruktur gehören die Gesamtheit aller Anlagen, Ausrüstungen und Betriebsmittel, die der Energieversorgung dienen (Vgl. Jochimsen 1966, S.103). Also gehören bei der Elektrizitätsversorgung neben dem Leitungsnetz auch sämtliche Umspannwerke, Kraftwerke und die Brennstoffe der Wärmekraftwerke zur Infrastruktur. Alle diese Elemente hängen stark voneinander ab. Eine Stromversorgung ist nur gewährleistet, wenn alle diese Elemente ausreichend vorhanden sind.
Da alle Anlagen, die der Energieversorgung dienen, zur Infrastruktur gehören, müsste man auch andere Anlagen außerhalb der Stromversorgung in die Untersuchung miteinbeziehen. Hier dürfte es jedoch in einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem kaum zu einem langfristigen Engpass kommen, da hier keine Marktunvollkommenheiten wie natürliche Monopole oder öffentliche Güter vorhanden sein dürften. Somit dürfte es zum Beispiel bei Versorgung mit Treibstoff oder Tankstellen keinen langandauernden Engpass geben, weil der freie Markt langfristig für Gleichgewicht sorgt. Deshalb wird im folgenden vor allem die öffentliche Stromversorgung untersucht. Hier ist ein langfristiger Engpass möglich, da es sich um ein natürliches Monopol handelt und in China der Staat bisher der alleinige Anbieter von elektrischer Energie ist und somit kein freier Wettbewerb für Ausgleich von Angebot und Nachfrage sorgt. Die Volksrepublik China ist eines der größten Länder der Erde. Damit Sie Ihr China Visum schnell beantragen können, sollten Sie frühzeitig mit Ihrer Reiseplanung beginnen. Aber es gibt viel zu sehen im Reich der Mitte und von daher empfiehlt es sich, einen Chinatravelguide zu Rate zu ziehen. Zahllose Städte und Landschaften locken mit ihren Sehenswürdigkeiten. Verlieren Sie nicht den Überblick Es besteht mit Sicherheit eine positive Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und Energieangebot. Dies lässt sich auf verschiedene Weise begründen. Wird mehr produziert, wird in der Regel auch mehr Energie benötigt, da Energie ein wichtiger Inputfaktor im Produktionsprozess ist. Man kann sich leicht vorstellen, wie ohne elektrische Energie die Produktion in einem Betrieb zum Erliegen kommt. Nach der allgemeinen Wachstumstheorie wird bei Wirtschaftswachstum Arbeit durch Kapital ersetzt. Wenn Arbeit durch Kapital (z.B. Maschinen) ersetzt wird, wird in der Regel mehr Strom benötigt, weil Maschinen im Gegensatz zum Menschen elektrische Energie benötigen. Wie viel mehr Energie für eine bestimmte Wirtschaftswachstumsrate benötigt wird, ist nicht so einfach zu bestimmen. Für die BR Deutschland gibt es eine Untersuchung von Flath. Er kam zu dem Ergebnis, daß zwischen 1960 und 1973 der Primärenergieverbrauch in der BR Deutschland um ein Prozent wuchs, wenn sich die gesamte deutsche Volkswirtschaft um ein Prozent vergrößerte (Vgl. Flath 1978, S.58). Wirtschaft und Energieverbrauch wuchsen also parallel. Dies muss jedoch nicht unbedingt auch für China gelten. Für die Analyse des zukünftigen Energiebedarfs ist auch von Bedeutung in welchen Sektoren und Brachen die Wirtschaft wachsen wird. In manchen Bereichen wird viel Elektrizität verbraucht, in anderen weniger. Während in der Landwirtschaft weniger Elektrizität benötigt wird, wird in der Industrie und auch in Teilen des Transportwesens (vor allem im elektrischem Schienenverkehr) vergleichsweise viel Strom benötigt. 78,2 % der Elektrizität in China wird von der Industrie verbraucht (Vgl. Statistisches Bundesamt 1993, S.77). Nach Minami verbraucht in China vor allem die Schwerindustrie eine große Menge an Energie (Minami 1994, S.52). Auch mit dem steigenden Lebensstandard wächst der Stromverbrauch in China rapide an, da immer mehr Haushalte überhaupt einen Stromanschluß bekommen und immer mehr Elektrogeräte im privaten Bereich genützt werden. Da allgemein erwartet wird, daß die Industrie, die vergleichsweise viel Elektrizität verbraucht, in China in der Zukunft wie in der Vergangenheit viel schneller als die Landwirtschaft wachsen wird, kann man davon ausgehen, daß in Zukunft die Energienachfrage schneller als die Wirtschaft wachsen wird. Für ein Prozent Wachstum der Wirtschaft ist also eher mehr als ein Prozent Wachstum des Gesamtenergiebedarfs zu erwarten. Bei der Nachfrage nach elektrischer Energie ist ein noch schnellerer Anstieg zu erwarten, da der Anteil der elektrischen Energie an dem gesamten Energieverbrauch in China ständig steigt (Vgl. Minami 1994, S.51). Insgesamt müsste also die Produktion an elektrischer Energie somit deutlich schneller als die Gesamtwirtschaft wachsen, um den zukünftigen Bedarf befriedigen zu können. 2.3.2. Mögliche Versorgungslücken in Gegenwart und Zukunft
Schon 1990 sah Robinson die Gefahr, daß eine rasche wirtschaftliche Entwicklung in China, ähnlich wie zuvor in Indien, am Mangel an Energie, insbesondere Elektrizität, scheitern könnte, wenn das Wachstum der Stromproduktion nicht mit dem des Wirtschaftswachstum allgemein mithalten würde (Vgl. Robinson 1990, S.246). In den letzten Jahren ist die Produktion von elektrischer Energie in China zwar stark angestiegen, das Bruttoinlandprodukt ist in den 90er Jahren jedoch in jedem Jahr noch schneller gewachsen:
Abb. 3: Vergleich zwischen Stromproduktion und Wachstum
Bemerkung: Stromproduktion 1996: Durchschnitt Januar bis November Quellen: Stromproduktion: United Nations 1997, S.87 Bruttoinlandprodukt (BIP): Schüller 1997b, S.339
Wie in der Abbildung zu sehen ist, ist in den letzten Jahren jedes Jahr die Stromproduktion schnell gewachsen. China baute seine Kapazität des Stromnetzes zu Beginn der 90er Jahre schneller aus als jedes andere Land der Welt (Vgl. The Economist 28.11.92, S.72). Dennoch ist die Elektrizitätsproduktion deutlich langsamer und nicht wie eigentlich erforderlich, deutlich schneller als die Wirtschaft gewachsen. Dadurch kommt es zu wachsenden Versorgungsproblemen. „The failure to increase electric power capacity in concern with industrial expansion has led to persistent power failures which have plagued urban China“ (Dorian 1994, S.232). Selbst die staatlich zensierten Medien geben das Problem inzwischen offen zu. „Die Energiewirtschaft weist zwar Erfolge auf, aber die Energieknappheit verschärft sich wegen des raschen Wirtschaftswachstums stetig“ (Beijing Rundschau 1/93, S.5). Da es in China kein landesweites Elektrizitätsnetz gibt, ist das Problem von Region zu Region sehr unterschiedlich. Das Problem ist besonders in Regionen mit hohem Wachstumstempo groß. Das sind vor allem die industriell aufstrebenden Städte an der Küste und die Region um Hongkong (Vgl. Schüller 1994, S.26). „In the costal provinces factories are being forced to operate at less than 75% capacity“ (The Economist 29.11.92, S.72). In der Boomprovinz Guangdong, die die Nachbarprovinz von Hongkong ist, sind die Probleme am größten. Für diese Provinz wird eine große wirtschaftliche Zukunft vorausgesagt. „Man rechnet damit, daß diese südchinesische Provinz noch vor Ende dieses Jahrhunderts Staaten wie Thailand oder Malaysia überholt und damit hinter Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur zum fünften kleinen Tiger wird“ (Nieh 1993, S.116). Jedoch könnte dies am Elektritzitätsmangel scheitern. Nach einem Bericht „müssen viele Fabriken aufgrund des Elektrizitätsmangels in einem Turnus von ´drei Tage Unterbrechung und vier Tage Produktion` oder sogar ´vier Tage Unterbrechung und drei Tage Produktion` arbeiten, so daß mindestens ein Drittel der Produktionskapazität ungenutzt bleibt“ (Schüller 1993b, S.1004). Im Verhältnis zu den anderen Wachstumsländern ist die Stromproduktion in China im Vergleich zur Wirtschaftskraft dennoch relativ hoch: Tab. 4 : Internationaler Vergleich der Stromproduktion
Quellen: BIP pro Kopf : Der Fischer Weltalmanach 1997, S.699- S.715 Produktion: United Nations 1997, S.87-90Einwohnerzahlen: Der Fischer Weltalmanach 1997, S.699- S.715 Bemerkungen: BIP Abkürzung für Bruttoinlandsprodukt Produktion pro Kopf und Produktion / BIP: eigene Berechnungen
In Tabelle 4 ist zu sehen, daß die Stromproduktion pro Kopf in China fast doppelt so hoch wie auf den Philippinen ist, obwohl das Bruttoinlandsprodukt deutlich niedriger ist. Auch im Vergleich zu anderen Ländern ist die Produktion von Strom im Vergleich zur wirtschaftlichen Leistungskraft in China sehr hoch. In China wird pro Dollar Bruttoinlandsprodukt mehr als doppelt so viel Strom produziert wie in allen Vergleichsländern. Eine generelle Aussage, daß in China zu wenig Strom produziert wird, läßt sich somit nicht treffen. „ In other words the ratio of electricity to GNP in China is very high. This does not reflect an over-abunance of electricity but rather that it is being used inefficiently“ (Minami 1994, S.53). Die Weltbank begründet den vergleichsweise hohen Stromverbrauch Chinas anders als Minami. Sie kommt zu dem Schluß, daß die chinesische Wirtschaft in Vergleich zu anderen Ländern eine besonders hohe Energieintensität hat (World Bank 1985, S.10). Somit ist ein Grund für den Strommangel in China, daß die Brachen, die viel Elektrizität benötigen, besonders stark ausgeprägt sind. Obwohl die Stromproduktion in China also relativ hoch ist, kommt es zu schweren Engpässen. Ein Hauptproblem liegt wie oben bereits angedeutet darin, daß es kein landesweit gut ausgebautes Stromnetz gibt. Jede Region produziert den Hauptteil des Stroms, den sie benötigt, selbst. Somit kommt es in einigen Regionen zu starken Engpässen, in anderen ist die Vorsorgung jedoch ausreichend. Dies liegt insbesondere an den schnellen Veränderungen in der chinesischen Wirtschaft, der die Infrastrukturausstattung hinterherhinkt. „Wichtigster Energieträger in China ist nach wie vor die Kohle, die mehr als zwei Drittel zum Energieverbrauch beiträgt“ (Schüller 1996b, S.1151). Da jedoch die Kohle vor allem im Norden gefördert wird, aber die neue Industrie und damit die Kraftwerke vor allem im Süden sind, muß die Kohle in den Süden transportiert werden. Auf Grund enormer Engpässe im Transportsektor, die ich später im Kapitel über die Verkehrsinfrastruktur darstellen werde, kommt es zu Transportengpässen. Im Jahre 1991 lagen 200 Millionen Tonnen Kohle im Norden auf Halde, während es im Süden empfindliche Nachschubschwierigkeiten gab (Vgl. Statistisches Bundesamt 1993, S.77). Die in großer Anzahl in den letzten Jahren neu gebauten Kohlekraftwerke in China können somit nicht mit voller Kapazität arbeiten. Somit ist zur Zeit weniger ein Mangel an Kraftwerken, sondern die Transporte der Brennstoffe das Hauptproblem. Auch wird in China mehr Strom als in anderen Ländern verbraucht, weil der Preis für Strom staatlich festgesetzt wird und niedrig ist. Diese staatliche Preisfixierung unter dem Marktpreis führt zu einem Nachfrageüberhang. Bei einem höheren Preis wären die Unternehmen gezwungen, zum Beispiel alte viel Strom verbrauchende Maschinen durch neue stromsparendere Maschinen zu ersetzen. Umweltprobleme werden in China immer mehr zum Thema. Besonders die Luftverschmutzung durch die Kohlekraftwerke wird zum Problem. In bestimmten Gegenden werden keine neuen Wärmekraftwerke mehr gebaut, weil die Luftverschmutzung schon die internationalen Grenzwerte überschritten hat. Auch ist China mit 12 % der Weltemission der weltweit zweitgrößte Produzent des Treibhausgases Kohlendioxyd (Vgl. Südwestpresse 25.5.97, S.8). Somit wächst der weltweite Druck auf China, die alten stark umweltverschmutzenden Kraftwerke abzuschalten und nicht mehr so viele neue zu bauen. 2.3.3. Lösungsmöglichkeiten Um das Versorgungsproblem mit Elektrizität zu lösen, wird in China versucht, neben der Kohle andere Energiequellen besser zu nützen. Besonders von der Atomenergie und der Wasserkraft erhofft man sich eine Lösung der Energieprobleme. Auch die Umwelt könnte so möglicherweise entlastet werden. Vor allem in der Strommangelgegend um Hongkong wird versucht das Problem mit Hilfe von Atomkraft zu lösen. Jedoch steht die Atomenergie in China erst am Anfang. Bis 1994 gab es in China nur ein kleines Atomkraftwerk. Im Jahre 1994 nahm in Südchina, nur wenige Kilometer von Hongkong entfernt, das erste große Atomkraftwerk des Landes in Daya Bay seinen Betrieb auf. Der Bau von weiteren Atomkraftwerken um Hongkong ist geplant. Dadurch will man von der Kohle unabhängiger werden und die Kohletransportengpässe verkleinern. Der Bau von Atomkraftwerken wird von der Bevölkerung jedoch mehrheitlich wegen des Sicherheitsproblems abgelehnt. Insbesondere in Hongkong gibt es starken Widerstand gegen die Atomenergie, so daß die Zukunft der Atomenergie unsicher erscheint. Auch müssen Atomkraftwerke fast vollständig importiert werden, da es an Know-how fehlt. Zumindest wird vor dem Jahre 2003 kein weiteres Atomkraftwerk fertiggestellt werden. In den Jahren 2003 und 2004 sollen dann vier weitere größere Atomkraftwerke ans Netz gehen. (Vgl. Schüller 1996b, S.1152) Insgesamt wird nicht damit gerechnet, daß der Anteil der Atomenergie bis zum Jahre 2010 auf mehr als zehn Prozent steigt. (Vgl. zur chinesischen Atomkraft: Schüller 1995, S.135) Mit der Atomenergie wird sich also in absehbarer Zeit nur ein kleiner Teil des Problems lösen lassen, auch wenn die chinesischen Regierungsmedien berichten, daß das 21. Jahrhundert „die Ära der Nuklearenergie“ (Beijing Rundschau 10/96, S.19) werden soll. Dagegen haben die im Bau oder Planung befindlichen Wasserkraftwerke in China ein viel größeres Ausmaß. Das Schlüsselprojekt ist der sogenannte Dreischluchtendamm in Südchina. Wird dieser einmal fertiggestellt sein, wird dies das bei weitem größte Wasserkraftwerk der Welt sein. Er soll einmal 84 Mrd Kilowatt Strom liefern. Eine Million Menschen müssen in den nächsten Jahren umgesiedelt werden, weil ihre Häuser von den aufgestauten Wassermassen überflutet werden. Für diese Menschen müssen neue Wohnungen gebaut werden. (Vgl. Schüller 1992, S.159) Ein 600 km langer und bis zu 185 m tiefer Stausee soll entstehen (Vgl. Statistisches Bundesamt 1993, S.77). Dieses Projekt ist jedoch selbst unter den chinesischen Spitzenpolitikern wegen der hohen Kosten und der gigantischen Umsiedlungen umstritten. Der Bau dieses Großprojekts wurde nicht einstimmig, sondern nur mehrheitlich beschlossen, was in Chinas Politik sehr selten ist. (Vgl. Schüller 1992, S.159) Inzwischen mehren sich die Stimmen gegen den Dammbau, so daß eine Fertigstellung des Damms nicht sicher erscheint. Besonders die ausländischen Firmen, die Kapital und Technologie liefern sollen, haben gegenüber dem Projekt eine zunehmend skeptische Einstellung (Vgl. The Economist 19.3.94, S.76). Auch ist nicht mit der Fertigstellung anderer größerer Wasserkraftwerkskapazitäten in den nächsten Jahren zu rechnen. Langfristig könnte jedoch die Wasserkraft durchaus helfen, die Versorgungsprobleme Chinas mit elektrischer Energie zu lösen. Im Jahre 1990 hatte die Wasserwirtschaft einen Anteil von 20% an der Stromproduktion (Statistisches Bundesamt 1993, S.77). Wasserkraftwerke waren somit der einzig wichtige Kraftwerkstyp neben den Kohlekraftwerken. Nach einer Untersuchung eines großen japanischen Forschungsinstituts hat China das größte Wasserkraftpotential der Welt. Nach dieser Untersuchung werden davon derzeit nur etwa 10% genutzt (Vgl. The Economist 19.3.1994, S.76). Somit ist langfristig durchaus denkbar, daß die Wasserkraft bei der Lösung von Chinas Stromversorgungsproblemen eine große Rolle spielt. Atomenergie und Wasserkraft werden also nur langfristig helfen den Mangel an Strom zu beseitigen. Kurz- und mittelfristig wird eine große Kohleabhängigkeit bestehen bleiben. Eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen, sind Investitionen aus dem Ausland. „Experience have shown, actively encouraging foreign investment is one effective method of raising funds for energy development“ (Dorian 1994, S.234). Nur mit Hilfe des Auslands können die Probleme schnell gelöst werden. So muß schnell ein großes landesweites Stromnetz gebaut werden. Damit kann dann ein großer Teil des Stroms, der im Süden benötigt wird, im Norden in der Nähe der Kohleabbaugebiete produziert werden und im Süden verwendet werden. Somit entfällt das Problem der Kohletransporte. Auch regionale Engpässe in der Stromversorgung können mit einem landesweiten Stromnetz behoben werden, weil dann die Elektrizität dort genutzt werden kann, wo sie benötigt wird. Desweiteren können mit ausländischem Know-how modernere westliche Kraftwerke gebaut werden. Der Wirkungsgrad ist in modernen Wärmekraftwerken höher, so daß mit der gleichen Menge Kohle mehr Elektrizität produziert werden kann. Eine weitere Möglichkeit den Elekrizitätsmangel zu verkleinern ist es, die Nachfrage nach Elektrizität zu begrenzen. Dies kann durch Preiserhöhungen vor allem in den Mangelgebieten erreicht werden. Durch die höheren Preise wird nicht mehr so viel Strom verschwendet werden und die Industrie und die Bevölkerung werden versuchen mehr Energie einzusparen. Auch wird die Industrie durch die höheren Preise gezwungen sein, alte energieverschwendende Produktionsanlagen aufzugeben und neue energiesparende Produktionsverfahren einzuführen. Dies gilt insbesondere für die größtenteils veralteten und unrentablen staatlichen Großbetriebe. Sie müssen geschlossen werden, weil der Strom für die modernen, neuen und privaten Industriebetriebe benötigt wird. Preiserhöhungen schmälern nicht nur die Nachfrage, sondern vergrößern auch das Angebot. Priddle (1996, S.124) glaubt, daß die niedrigen Energiepreise gefährliche Barrieren für neue Investitionen im Elektritzitätsbereich sind. Durch marktgerechte Preise könnte also die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage im Elektritzitätssektor verkleinert werden. Der Ausbau von Wirtschaftszweigen mit hohem Strombedarf muß vor allem im Süden vorläufig stark eingeschränkt werden. Zweidrittel des industriellen Energiebedarfs wird in China von der Eisen-, der Stahl-, der Chemie- und der Baustoffindustrie verbraucht (Vgl. Priddle 1996, S.104). Zukünftige Produktionsstätten dieser Industriezweige sollten in den Regionen Chinas angesiedelt werden, in denen es genug Elektrizität gibt. Auch an die vorübergehende Stillegung von einigen alten, weniger rentablen Betrieben mit hohem Stromverbrauch muß vor allem in Südchina gedacht werden. Der so gewonnene Strom könnte in den neuen boomenden Leichtindustrien eine sinnvollere Verwendung finden. 2.3.4. Fazit Die Vergrößerung der Produktionsmenge an elektrischer Energie ist nicht die einzige Lösung für Chinas Energieproblem. Dennoch muß China, um die steigende Nachfrage bei weiterem Wachstum decken zu können, die Produktion von Elektrizität weiterhin stark erhöhen. Daneben muß jedoch auch über Strompreiserhöhungen vor allem in den Strommangelgebieten die Nachfrage vorläufig begrenzt werden. Das wichtigste Problem, das Fehlen eines landesweiten Stromnetzes, muß unbedingt in den nächsten Jahren behoben werden. Bis dahin muß zum einen zumindest der Ausbau der energie-intensiveren Industriebrachen in den Strommangelgebieten, vor allem in Guangdong, eingestellt werden. Zum anderen müssen neue Industriebetriebe schwerpunktmäßig in dem energiereicheren Nordchina angesiedelt werden. Insgesamt ist das Problem durchaus nicht unlösbar. Jedoch ist es nur mit noch größeren Anstrengungen als bisher zu lösen. Die Infrastruktureinrichtungen zur Enegieversorgung können ohne eine schnelle Lösung der Probleme in vollem Umfang einen entscheidenden Engpaß in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung Chinas darstellen. Werden diese Probleme nicht schnellstens gelöst, ist ein weiteres Wachstum der chinesischen Wirtschaft mit zweistelligen Wachstumsraten bald nicht mehr möglich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||